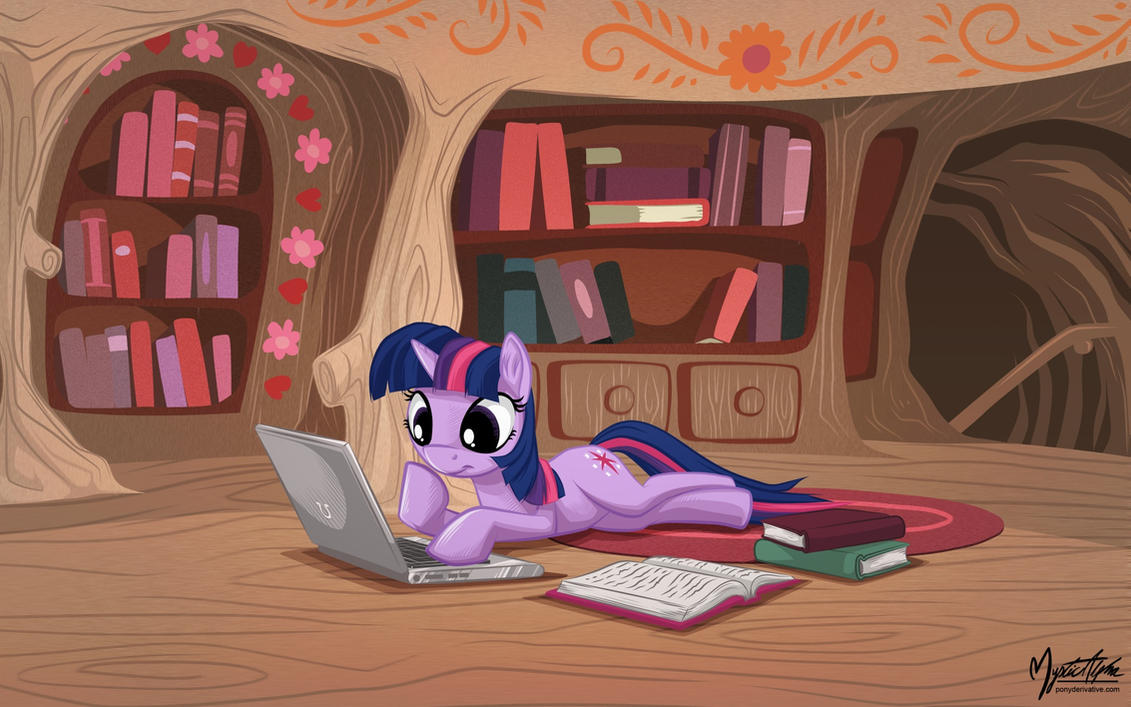Jeder Treffer ins Töpfchen ist eine Windel weniger, die gewaschen (oder gekauft) werden muss. Das Kind muss nicht im Nassen sitzen. Die Eltern freuen sich, das Kind, freut sich, die liebe Umwelt freut sich und lässt die Sonne noch heller scheinen und den Wind noch fröhlicher wehen. Oder so.
Das Thema Windeln loswerden ist für Eltern/Erziehende oft ein sehr großes. Vergleichbar vielleicht fast mit laufen oder sprechen lernen, um bei Elternthemen zu bleiben. Oder so spannend wie der Release eines neuen iPhones unter Apple-FanPeepz.
Beim zweiten Kind haben wir kurz vor dem ersten Geburtstag mit „TopfFit“ (=„Windelfrei“) begonnen. Und ich gebe ja grundsätzlich keine – ungefragten – Kinder-Erziehungs/-Pflege/-etc-Tipps, aber im Nachhinein denke ich dann doch mittlerweile:
Windeln? Bloss nicht damit anfangen.
Kommunikation und Timing
Ein Grund für uns, „das mit dem TopfFit“ zu versuchen, war die Tatsache, dass eigentlich schon direkt nach der Geburt sichtbar gewesen ist: das Kind macht nicht gerne in die Windel. Und eigentlich hat es auch immer schon vor dem Geschäftchen Bescheid „gesagt“. Das heißt, Inne gehalten, angestrengt geguckt, manchmal geweint; you name it.
Windelfrei heißt nämlich nicht – das habe ich in Gesprächen das ein oder andere Mal gehört – Konditionierung und Töpfchentraining. Ein Schlüssel zum freudigen Erfolg und der oben genannten strahlenden Sonne ist die Ausscheidungskommunikation. … Die wohl auch in der TopfFit-Theorie der erste Schritt zur Windelfreiheit und Trockenheit ist. Hier müsste ich noch mal die einschlägige Literatur konsultieren. Oder ihr googlet das. Kommunikation heißt für die Eltern hier vor allem: darauf achten, was das Kind macht, bevor es was macht und mitzuteilen, dass dies mitbekommen worden ist.
Ein paar Gedanken über das Timing zu verlieren, schadet auch nichts: morgens kurz nach dem Aufstehen oder nach dem Mittagsschläfchen ist bei uns erst mal Topfzeit. Und das klappt eigentlich immer.
BabySignal macht’s noch ein bisschen einfacher
Wie schon in meiner ersten Elternzeit, habe ich mich auch mit dem zweiten Nachwuchs zu einem BabySignal-Kurs angemeldet. Kinder haben dort – soweit das über lachende Gesichter interpretierbar ist – viel Spaß und hörende Kinder lernen schneller über Gebärden zu kommunizieren, als über Lautsprache. Mit etwa 13 1/2 Monaten, also schon nach den ersten Ausscheidungskommunikationsversuchen, begann der Kurs. Viel später als beim ersten Kind (mit ca. 7 Monate), aber dafür mit umso schnelleren Lernerfolg. Und neben Begriffen wie „Flugzeug“, (Licht) „an/aus“ oder „Musik“ sind sehr schnell auch die Gebärden für „Kaka“ und „Pipi“ ins kindliche Kommunikationsrepertoire aufgenommen worden. Und wenn auch die „Erfolgsquote“ nach jetzt (insgesamt) vier Monaten Topf-Fit sehr schwankend (kein bis ca. sechsmal am Tag „daneben“) ist, hat das Gebärden, die ganze Sache doch arg vereinfacht. Auch kleine Kinder halten erstmal ein, wenn sie müssen und kommunizieren dies. Mit zunehmenden Alter natürlich etwas länger. Und mit ein paar Gebärden lässt sich dann auch zurück kommunizieren: „Ja, warte kurz, ich hab’ verstanden, dass du musst, ich bau’ dir mal fix dein Klo auf.“
Helferlein
Was ich statt einem Riesensack Windeln unterwegs fast immer dabei habe ist unsere Potette Plus, ein praktisches kleines Klapptöpfchen, das entweder als Sitzverkleinerung für Toiletten oder aber mit Plastiktüte als Reisetopf verwendet werden kann. Super für unterwegs. Es ist übrigens ganz und gar nicht nötig, die Original-Tüten für fünf bis acht Euro pro Zehnerpack zu kaufen. Die kostenlosen Standardplastiktüten vom Gemüseladen oder Markt tun es auch. Zumindest wenn ein Mülleimer für das vollgemachte Säckchen in absehbarer Entfernung ist. Bloß Obacht vor Löchern! 😉
Wer wissen möchte, wie das in der Praxis aussieht, kann sich dieses schlimmes Pottete-Werbevideo ansehen.
Während es zu Hause dank pflegeleichtem Fußboden im Zweifelsfall eine Unterhose tut, finde ich für unterwegs für die Übergangszeit übrigens „Trainerhosen“ doch sehr praktisch. Wenn das Bescheidsagen nicht klappt. Dazu finde ich die Best Bottom Training Pants sehr chic, auch wenn sich bei einer von uns gerade eine Naht etwas löst.
tl;dr
Ich bin begeistert, wie gut das TopfFit-werden klappt, hänge weniger Windelwäsche auf und habe den Eindruck, dass die Windelfreiheit für’s Kind auch gut und richtig ist.
Noch Fragen? Gerne.